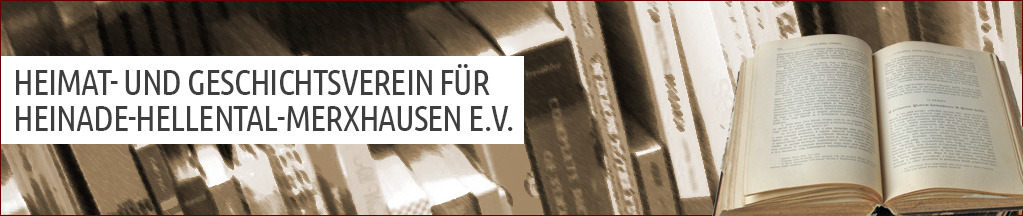Der jüdische Friedhof
Klaus A.E. Weber

Jüdischer Friedhof Lauenförde 1821-1911
HGV-HHM, Fotos: Klaus A.E. Weber
Haus des Lebens – Haus der Ewigkeit
„Jüdische Friedhöfe sind die letzten Zeugen Jüdischen Lebens in Deutschland bis 1945.
Sie geben Auskunft über die Größe der jeweiligen Jüdischen Gemeinde, über den sozialen Status und den Prozess der Emanzipation, Akkulturation und Assimilation bis hin zum Ende dieses Prozesses, der sein Ende in der Shoah fand.“
Aus einem Geleitwort von Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen [5]

Jüdischer Friedhof Merxhausen - angelegt abseits des Dorfes │ Dezember 2018
© HGV-HHM, Foto: Klaus A.E. Weber
„Hier ruhet in Gott“
An einem Südhang eines nach dem Heukenberg vorspringenden Ausläufers des Nordsollings, etwa 500 m nordwestlich von Merxhausen nahe der alten Einbecker Heerstrasse liegt der jüdische Friedhof Merxhausen - angelegt außerhalb bäuerlicher Nutzflächen und des dörflichen Wohnbereiches.[1][3]
Der alte Friedhof, mit einer Belegungszeit des Gräberfeldes von 1867-1934, ist eine umgrenzte Rechteckanlage (34 x 30 m), deren abgesonderte Lage seit altersher ein typisches Zeugnis gesellschaftspolitisch erzwungener Ausgrenzung lebender wie toter Juden darstellt.[2]
Zur jüdischen Bestattungs- und Grabkultur mit regionalen Besonderheiten, dem Friedhof als „Haus des Lebens“ oder als „Haus der Ewigkeit“, zu Bestattungsritualen und Trauerzeit sowie zur Anlage und Gestaltung der Begräbnisstätte, zu Grabsteinen mit ihren Inschriften, Symbolen und Ornamente und zur Sprache wird auf das entsprechende Kapitel in dem 2014 erschienenen Buch von HERBST/SCHALLER [6] verwiesen.
Archäologisches Denkmal
Jüdischer Friedhof, Merxhausen
Baudenkmal Gruppe
Heinade
ID:26973485
Grabsteine (Mazewa) der Familie Rothschild 1867-1934
Grabsteine aufzustellen, ist ein alter jüdischer Brauch.
Noch heute gut erkennbar bestehen 15 Grabstellen in Nord-Süd-Lage,.
Vermutlich gibt es hierunter auch vier Kindergräber.
Acht relativ gut erhaltene, an der Grabnordseite stehende Grabsteine - Mazewa – weisen, wenn auch weitgehend formgleich erscheinend, abweichende Gestaltungsformen aus Sand- oder Kunststein auf.
Neben Grabstelen bestehen auch Grabplatten.
Die aufrecht stehenden Grabsteine haben einen Sockel, dem der Hauptstein aufgesetzt ist.
Die Inschriften der Rückseiten sind hebräisch sprachlich und tragen alle den Namen "Rothschild".
Soweit erkennbar, kam es nicht zu einer Grabschändung und Störung der Totenruhe wie im Falle des jüdischen Friedhofs in Lauenförde im Jahr 1944.[4]
„Haus des Lebens“ – „Haus der Ewigkeit“ bei Merxhausen │ Januar 2009
© HGV-HHM, Foto: Klaus A.E. Weber
Die Inschriften von neun Grabsteinen sind bei HENZE/LILGE [2] und MITZKAT/SCHÄFER [3] dokumentiert.
Das älteste Grab trägt die Jahreszahl 1867, das letztes die Jahreszahl 1934.
Ephraim Rothschild
23. April 1859 - 04. Juli 1934
Merxhausen
Julius Rothschild
14. September 1853 - 10. September 1921
ohne Aufsatz und Namenstafel
vermutlich: Dr. Rothschild
Henriette Rothschild, geb. Nordheimer
25. Mai 1825 - 31. Mai 1895
Samson Josef Rothschild
24. Juli 1785 - 17. Januar 1867
Moritz Rothschild
7. März 1857 Zorge/Harz - 23. Juni 1917 London
Salomon Rothschild
25. Dezember 1863 - 28. Dezember 1930
Frau S. R. Phys(ikus)
Dr. Rothschild, Emilie geb. Weiler
13. April 1834 Brakel - 20. Juni 1907 Zorge
"Nach 54jähr. glückl. Eheleben ruht dieselbe neben ihrem Gatten"
Kaufmann Joseph Rothschild
8. Juli 1811 - 17. Juni 1887
______________________________________________________________
[1] Eine ausführliche Beschreibung des jüdischen Friedhofes und der mit ihm verbundenen Geschichte der Familie Rothschild in Merxhausen wurde von HENZE und LILGE im Jahrbuch des Landkreises Holzminden veröffentlicht [1989, S. 139-148].
[2] HENZE/LILGE 1989, S. 141 ff.
[3] MITZKAT/SCHÄFER (o.J.), S. 42-45.
[4] HERBST 2021, S. 89.
[5] HERBST/SCHALLER 2014, S. 8.
[6] HERBST/SCHALLER 2014, S. 135-148.